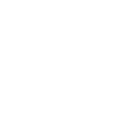Jeder Ort schreibt auch seine eigenen Geschichten. Wie schon meine kleine Erinnerung an den „Berjer Peter“, gibt es wohl noch viele „alte“ Geschichten mehr, die es wert sind erzählt zu werden. Aus diesem Grunde habe ich diese Unterrubrik erstellt, um zu verhindern, dass diese „Erinnerungen“ im Laufe der Zeit verloren gehen.
Ich würde mich auch freuen, wenn mir die eine oder andere Geschichte „erzählt“, also mir übermittelt würde, um diese hier weiter zu geben.
Beginnen wir mit den Erinnerungen meines Vaters Otto Ebling an den:
“Guts-Adam”
Zu den bekannten, aber nur noch den älteren Mitbürgern in Erinnerung, ist der “Guts-Adam”. Sein Haus stand an der Stelle wo heute die Tierarztpraxis steht.
Der Guts-Adam wohnte in einem kleinen einstöckigen Haus, mit kleinen Fenstern zur Straßenseite hin. Die Räume waren einfach und schlicht gehalten. An der Außenwand standen Bänke und an der Schmalseite war eine kleine Theke auf der Tabakwaren, wie Zigarren, Stumpen und auch loser Tabak für die Pfeife und Kautabak standen. Zigarren und Pfeifentabak waren auch zu dieser Zeit teuer und so sah man viele Männer nur mit dem Kautabak im Mund.
Aber ganz rechts stand das, was für Kinder interessant war, die „Gutsjersgläser mit den Himbeergutsjer und Lakrize”. War man mit dem Vater dort, der auch auf Kautabak stand, bekam man für 5 oder 10 Pfennig einige Gutsjer gekauft.
Kam man allein, um den schwarz-braunen Kautabak zu kaufen, meistens kostete er dann 50 Pfennig, gab es einige Gutsjer umsonst. Aber mit dem Hinweis, geh aber gleich häm, dei Vadder wart schun.
Beim Guts-Adam war Treffpunkt der Raucher und Tabakkauer und so fiel manches ma der Aufenthalt der Männer etwas länger aus. Wenn man dann bei der Wollebas vorbei ging, um den Vater zu holen, rief diese schon gleich: Wo sollen dann die Mannsleit sunscht sinn, als wie drowe beim Adam.
Neben dem Haus vom Guts-Adam war die Wäschbach. Von der Straße aus führte eine steile Treppe hinunter zum Sandsteinbecken. Das Wasser kam aus dem Überlauf, der an der anderen Straßenseite gelegenen Brunnenkammer. Das überlaufende Wasser aus dem „Wäschtrog“ lief in einem kleinen Graben bis zu den Wiesen, wo das Wasser aus dem Hirschbrunnen und das Oberflächenwasser weitergeleitet wurde in Richtung Unterdorf. Die Sauberhaltung der Wassergräben oblag den Gemeindearbeitern.
Das Todesjahr des Guts-Adams ist mir nicht bekannt. Die hier geschilderten Geschehnisse stammen aus der Zeit zwischen 1937 und 1939. Wer noch näheres weiß, kann es mir freundlicherweise mitteilen.
Erntezeit in Erfenbach
von Helge Ebling
In den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts war bei der Feldarbeit noch viel Handarbeit vonnöten. Unter anderem wurden die „Grumbeere“ oder die „Dickworzele“ noch von Hand gelesen. Zur Erntezeit suchten die Bauern Helfer für die Lese. Meist waren es Frauen, die zu Hause ihre Kinder groß zogen, sich dabei etwas dazu verdienen wollten und um die Kartoffeln für den Winter zu erarbeiten.
Mein Mutter Anneliese Ebling war auch bei den fleißigen Helferinnen, die jeden Spätsommer/Herbst auf den Feldern mithalfen. Da ich nicht alleine zu Hause bleiben sollte, wurde ich immer mitgenommen. Für uns Kinder, die dabei waren, war es immer ein tolles Abenteuer, für die Helfer schwere Arbeit. Reihe für Reihe wurden die herausgezackerten Kartoffeln in Körbe gelesen, die dann vom Bauer oder den männlichen Helfern in den Anhänger gewuchtet wurden. Die „Dickworzele“ wurden herausgezogen, in Reihen gelegt, das Kraut mit dem Beil abgehackt und dann direkt auf den Anhänger geworfen, was viel Kraft erforderte.
Meist halfen wir bei Familie Bodenstein, im Ort bekannt als die „Mehlbacher“, da Frau Bodenstein und ihre Mutter ursprünglich aus Mehlbach stammten. Deren Bauernhof war in der Siegelbacher Straße etwas unterhalb des „Restaurant Kapellenhof“. Herr Bodenstein selbst war für mich als Kind eine sehr beeindruckende Person, ein sehr großer kräftiger Mann mit einer sehr lauten Stimme ;-).
Frau Bodenstein, im Ort „Mehlbacher Irmgard“ genannt und die Oma Weißmann „es Mehlbacher Katche“, die im hohen Alter immer noch mithalf, waren nette freundliche Bäuerinnen. Oma Weißmann, von der schweren Arbeit stark gebeugt, hatte immer ein nettes Wort für mich übrig. Ihr oblag es meist sich um das Essen und die Getränke zu kümmern, die auf das Feld mitgenommen wurden. Die Helfer bekamen in der Pause Kaffee und belegte Weck und für mich als Kind war immer ein Becher Kakao und zusätzlich ein Kaffeestückchen dabei. Wie habe ich diese Tag auf dem Feld genossen... ich schmecke heute noch den Kakao und den „Worschtweck“ und habe immer noch den Geruch der abgeernteten Felder in der Nase...dieser Geruch nach schwerem Ackerboden... nach Kartoffeln und Rüben... Oft durfte ich auf dem Traktor mitfahren, ich als kleiner Junge neben dem riesigen Herrn Bodenstein oder dessen ebenso großen Sohn. Als ich etwas älter war durfte ich den Traktor ab und an selbst ganz langsam durch die Reihen steuern, eine kurze Einweisung und schon gings los...was war ich aufgeregt, aber auch stolz wie ein König ;-)
Nach der Kartoffelernte wurde das verdörrte Kartoffelkraut zusammengerecht und es wurde ein großes Kartoffelfeuer angezündet. Einige bei der Lese übersehenen Kartoffeln wurden dazu geworfen und nachdem das Feuer herunter gebrannt war, hatte man leckere gebackene Kartoffeln.
Die Zeit nach der Getreideernte war ebenfalls eine tolle Zeit für uns Kinder, denn dann waren auf den Feldern die Strohballen verteilt. Nicht diese großen runden Ballen die man heute findet, sondern die kleinen viereckigen, die man so wunderbar zum Strohhaus bauen nutzen konnte. Es entstanden riesige Gebilde mit unzähligen Tunnel, durch die man ins Innere gelangte...auch dieser Geruch des frisch geschnittenen und gepressten Stroh ist mir immer noch in der Nase...
Wenn „Dickworzelzeit“ war, war auch die Zeit der „Rübengeister“, oder hier bei uns den “Raachdeiwel”. Ich bekam eine „Dickworzel“ mit nach Hause und am Tag vor Allerheiligen hab ich die Rübe ausgehöhlt und eine schreckliche Fratze...zumindest für uns Kinder war sie schrecklich ;-)... hinein geschnitzt. In die Rübe kam eine Kerze und das ganze wurde dann abends ins Fenster gestellt. Eine Tradition, die heute leider ausgestorben ist oder durch das amerikanische Halloween ersetzt wurde.
Nachdem die komplette Ernte eingebracht war, traf man sich nochmals auf dem Hof, um seine Lohn ausgehändigt zu bekommen und um gemeinsam das Erntedankfest zu feiern.
Heute denke ich immer noch gerne an diese Zeit zurück, spätestens dann, wenn ich im Herbst einen einsamen Traktor mit Vollernter seine Bahnen über die Felder ziehen sehe... für die Bauern bestimmt eine ungeheure Erleichterung...für die Kinder, die das in dieser Form wie ich es erlebt habe, nicht mehr erleben dürfen, finde ich es sehr schade...
Der Schlange Sepp
von Otto Ebling
Josef Schlang, der letzte Gemeindehirte in Erfenbach. Er war für alle nur der „Schlange Sepp“, er soll das Schneiderhandwerk erlernt haben, war aber auch als Altmaterialsammler mit seinem „Handkärchelche“ unterwegs und nach dem ersten Weltkrieg als Gemeindehirte angestellt, wo er bis ca. 1933/34 tätig war.
Über den Schlange Sepp wäre noch einiges zu berichten. Sein Enkel,Walter Schlang, Sohn von der Tochter von Helene Schlang (Schlangehelene ) wurde im Jahre 1940 mit mir eingeschult und so war ich auch des öfteren auf der Schlangenburg, die hoch über der Jahnstraße, der damaligen Ludwigstraße, thront.
Das Haus von Josef Schlang war einst ein Gemeindehaus und wurde dem Schlange Sepp, der ja zeitweise bei der Gemeinde als Hirte angestellt war, überlassen. Josef Schlang war in dieser Zeit ein schon etwas gebrechlicher Mann, hatte aber einen ungebrochenen Arbeitswillen.
Da wir ja in der Kriegszeit waren, hatten er und seine Frau Helene nur sehr wenig zum Leben und beide mussten sich mühsam durchschlagen.
Da die Frau vom Sepp zu dieser Zeit schon fast blind war, musste ihr Mann im Haushalt vieles alleine machen und so blieb vieles liegen. Holz und Kohlen waren knapp und so ging der Sepp
öfters einmal in den Wald, der ja direkt oberhalb des Hauses lag. Es interessierte den Sepp nicht, ob der Wald jetzt den Christmanns oder den Mohren gehörte und da er ja wenig Holz von der Gemeinde zugeteilt bekam, ging er Bäume fällen.Er lagerte sie am Hang hinter dem Haus, gut getarnt mit Hecken und Laub fand niemand so schnell das Holz.
Zu Anfang sagte ich ja höflicherweise immer Herr Schlang zu ihm, aber dann hieß es: Wenn Du noch einmal Herr Schlang zu mir sagst, schlage ich Dir eine aufs Ohr. Also ließ ich es.
Interessant ist noch dabei, dass wenn wir aus der Schule kamen und er uns von der Treppe aus kommen sah, passte er auf ob ich auch mit seinem Enkel Walter zur Schlangenburg hoch kam und den Weg durch den Wald nahm. Dann rief er schon von weitem: Geh doch durch den Wald, da ist es näher.
Seine Frau,die uns nicht mehr erkennen konnte, aber uns an der Stimme erkannte, rief uns, wenn wir unterwegs einmal etwas mehr bummelten, dann die schlimmsten Worte zu. Trotz der Armut der beiden, wollten sie mir immer was zu Essen geben, doch ich wusste ja Bescheid und lehnte es immer ab. Ob sie mir glaubten, dass ich keinen Hunger hatte, eher nicht. Enkel Walter stellte mit seinem Großvater doch des öfteren viel Blödsinn an. Einmal schloss er Opa und Oma in ihrem Zimmer ein oder er versteckte das Beil, so dass der Großvater kein Holz im Walde holen konnte. Dann rutschte auch dem Großvater die Hand aus und dann war das Geschrei auf der Schlangenburg groß.
Ansonsten kam man mit dem Schlange Sepp gut zurecht, man musste halt seine Launen akzeptieren.
Für seinen Enkel Walter war er trotzdem ein guter Großvater, denn er sorgte, trotz der Armut die im Hause herrschte dafür, dass, wenn auch wenig, immer was zu Essen da war.
Es würde noch mehr über den Schlange Sepp zu berichten geben, aber das gehe dann mehr in Richtung Familienleben und darüber schweigt man.
Die Amerikaner in Erfenbach
von Otto Ebling
Mit meinen Erinnerungen beginne ich im Jahre 1944, mit der Zeit vor Kriegsende bis zum Kriegsende. Im September, es war der 28., griffen die amerikanischen Bomberverbände Kaiserslautern an. Es war ein unheimliches Farbenspiel am Himmel in Richtung Wiesenthalerhof. Selbst von unserem Haus aus sah man die rote Feuersbrunst über dem Wald und ein ungeheurer Lärm lag in der Luft. Vom Himmel regnete es Staniolstreifen, die einen Schutz vor Ortung durch das Radar bringen sollten. Diese Staniolstreifen wurden dann tagsüber von uns Kinder eingesammelt und noch lange Zeit aufbewahrt. Dann ging es auch bei uns über Efenbach los. Es war eine stockdunkle Nacht, aber die Leuchtschirme, die die Flugzeuge warfen, erhellten den Boden.Dann hörte man nur noch das Krachen der Bombeneinschläge. Ein Lärm, den man noch nie vorher gehört hatte. Brandbomben und Sprengbomben fielen auf die Häuser an der Siegelbacher Straße.Wir flüchteten in einen Raum, der an das Haus angebaut war und wo wir wussten, dass die Betondecke etwas aushält. Kurze Zeit später ebbte der Lärm ab und wir sahen, dass die Katholische Kirche vom Turm aus lichterloh brannte. Schon hörte man das Geschrei der Leute, die helfen wollten um zu löschen, aber es war vergebens. Doch schon wieder war Fluglärm zu hören und die zweite Welle kam und flog Richtung Otterbach.
Jetzt war die Lampertsmühle und der Bahnhof Otterbach ihr Ziel. Nachdem wieder Ruhe eingekehrt war, durchsuchten wir die Umgebung unseres Hauses, doch wir fanden im Moment nichts. Dann stellte sich heraus, dass eine Brandbombe die dünne Decke im Schlafzimmer durchschlagen hatte und vor dem Fenster auf dem Boden lag, aber zum Glück nicht gezündet hatte. Wir rissen das Fenster auf und warfen die Bombe auf das angrenzende Grundstück.
Am Morgen lagen, wohin man auch blickte, überall Brandbomben. Hinter unserem Haus hatten wir, wie es damals so üblich war, auch einen Aschehaufen. Dort fanden wir in der trockenen Asche ein Bündel Brandbomben, das noch mit einem roten Ring zusammengehalten wurde und sich nicht in der Luft gelöst hatte. Die meisten Bomben fielen auf die weiche Ackererde. Es waren hunderte von Bomben, die zwischen Kirchberg und Gottliebshöhe lagen.
Durch regelmäßige Unterrichtung seitens der Feuerwehr über den Brandschutz und die Wirkung der Brandbomben, die pilzförmig aufspringen und dann der Phosphor zu brennen anfängt, wussten wir, dass im rot gefärbten Teil der Brandbombe der Aufschlagzünder war und so konnte man die Bomben einsammeln, die wir dann auf dem Feld sammelten. Steckten sie im Boden durfte man sie nicht heraus ziehen. Wir gingen dann zum damaligen Feuerwehrkommandanten und sagten ihm, dass über den ganzen Berg verteilt, auch im Garten von Johann Müller und vor dem Haus von Frau Mertel Bomben liegen und die alte Frau sich nicht mehr aus dem Hause traut, aus Angst die Bomben explodieren. Darauf kam dann später ein Bergungstrupp, der alles unschädlich machte.
Ja, dass war der Angriff auf Erfenbach, aber wir hatten schon lange vor diesem Angriff mit dem Bau unseres Bunkers hinter dem Haus von Christmann Peter (Der Mann der den Ziegenbock hatte) und seiner Schwester Babette begonnen. Wir hatten ja nur wenig Zeit um mit dem Bau voran zu kommen, denn oftmals wurden wir durch Luftangriffe von der Baustelle gejagt. Der Bunker wurde in den roten Sandsteinfels gehauen und der Abraum wurde als Splitterschutz vor und seitlich des Einganges aufgehäuft. In sehr mühevollen Stunden gelang es uns einige Meter fertig zu stellen. Oft standen wir im Sickerwasser, das von der Felsendecke rieselte. Nach einigen Metern im Stollen wurden seitlich an den Wänden Nischen gehauen,wo wir dann bei Luftangriffen saßen.
Wir wollten eigentlich nicht gerne in den Bunker und gingen davon aus, dass uns die Flugzeuge auf dem Berg nicht finden würden. Im Jahre 1945, gleich zu Beginn im Januar, waren die Angriffe fast täglich. Meistens kamen wir in den Nächten nicht zum Schlafen, da ein Bomberverband nach dem anderen über uns hinwegflogen. Die Artilleriegeschütze standen auf der Siegelbacher Höhe, die dann sofort das Feuer eröffneten. Dann sahen wir im Scheinwerferlicht die vielen kleinen Pulks die silbrig glänzten.
In den Nächten hörten wir die Radiostationen Beromünster (Schweiz) und Berlin ab. Unseren kleiner Volksempfänger hatten wir auf dem Tisch aufgestellt, um zu erfahren wo die Angriffe stattfanden. Es war zwar strengstens verboten ausländische Sender zu hören, aber unser Vater kannte die Sender und wies uns darauf hin. Dort hieß es dann: Feindliche Bomberverbände fliegen in das Deutsche Reich ein...oder die Flugzeuge befinden sich im Anflug auf Ludwigshafen. Wenn wir dann die ersten Angriffswellen hörten, gingen wir des Nachts noch schnell einmal um das Haus herum um zu sehen, dass ja kein Licht durch die Ritzen der Fensterläden drang. In dieser Zeit wurden wir von dem Luftschutzwart in Erfenbach über verschiedene Verhaltensmaßnahmen informiert und in den Nachtstunden war der Gebrauch von Lampen, ja sogar Taschenlampen streng verboten.
Waren die Bomberverbände dann direkt über uns, wussten wir, wenn sie sehr hoch flogen, sie fliegen heute wieder in Richtung Rhein. Des öfteren rief uns Onkel Nickel, der Mann unserer Tante Erna, schon vom Hof aus zu: Kommt schnell in den Bunker, heute fliegen sie wieder tief. Das hieß dann, das notwendigste in die Hand nehmen und rennen.
Einmal,wir waren zu dritt auf dem Weg von der Gaststätte unseres Großvaters (Otto Ebling) hinauf auf den Berg zu unserem Haus, wurden wir von einem Jagdflugzeugangriff überrascht. Die Maschine kam aus Richtung Maienberg und flog so tief, dass wir die Besatzung erkennen konnten. Da hieß es sich sofort fallen lassen, egal wie steinig der Weg war. Die Fliederbüsche deckten dann die Sicht auf uns ab. Über dem Dorf drehte dann die Maschine in Richtung Siegelbach ab. Ja und so ging es weiter bis zu dem Tage, wo es hieß: Der Krieg ist bald zu Ende. Aber Anfangs März wurden noch Angriffe geflogen. Unsere Soldaten waren von Westen kommend auf der Flucht. Ein heilloses Durcheinander entstand und so lösten sich die Truppenverbände auf und wer floh besorgte sich bei der Bevölkerung noch schnell Zivilkleider und macht sich auf den Weg nach Hause, was aber vielen nicht mehr gelang.
Am Anfang und Ende von Erfenbach waren Panzersperren gebaut worden, denn man war der Meinung, dass kein Panzer hier durch kam. Aber wie sich später heraus stellen sollte, waren sie kein Hindernis für diese Kolosse.
So sah man das Ende des Krieges kommen, aber die Bevölkerung wurde weiter durch Parolen des Propagandaministeriums eingeschüchtert. Einmal hieß es, alles wird erschossen, wenn man auf der Straße oder an der Tür ist. Dann wurden wir aufgefordert Fotokameras, Fahne, Bücher, Bilder und Waffen zu verstecken oder zu verbrennen.
Die Besonneneren rieten aber dazu, wenn die ersten Amerikaner auf das Dorf zurollten, sollte man weiße Leintücher in die Fenster oder Türen hängen, zum Zeichen, dass wir uns ergeben und keine feindlichen Handlungen vorhaben.
Und der Tag der Ankunft der Amerikaner kam schnell.
Ankunft der Amerikaner
Viele unterschiedliche Meinungen und Vorhersagen schwirrten durch das Dorf. Einmal hieß es, die Amerikaner sind bereits in Kaiserslautern, dann wieder hieß es sie sind erst bei Homburg und andere sagten sie wären bei Kusel. Keiner wusste es wirklich genau und wir hatten uns entschlossen, alles was wir an Lebensmittel hatten, zuerst einmal an einen sicheren Platz zu bringen. Dann richteten wir verschiedene Kleidungsstücke für den Notfall.
Wir wussten ja nicht, ob es zu einem Angriff kommen würde, deshalb wollten wir gerichtet sein um noch schnell den Bunker zu erreichen.
Wir warteten dann am 19.März 1945 zu Hause ab, was geschehen würde. Geweckt wurden wir dann vom Geräusch der Panzer und da war es so gegen 23.00 Uhr. Damals war die Straße nach Siegelbach beidseits mit Bäumen bestanden. Undeutlich sah man Lichter zwischen den Bäumen, dann kamen das Kettenrasseln näher. Für uns war klar, das sind die Amerikaner. Wir wussten nur nicht, ob sie Richtung Erfenbach fuhren, denn in der Dunkelheit sah man die viele Lichter, die hoch und runter fuhren. Dann herrschte plötzlich gespenstige Stille !!!
Wir waren uns aber sicher, die Panzer sind in Erfenbach. An Schlafen hat niemand mehr gedacht. Unsere Mutter saß am Tisch und mein Bruder Horst und ich auf der Holzkiste.
Abwarten bis zum Morgen war das einzigste was uns übrig blieb. Gegen Morgen, es wurde schon langsam hell, klopfte es an die Tür. Wir standen da und wussten nicht ob wir Antwort geben sollten. Dann eine Stimme: Es war der Großvater,er wollte einmal nachsehen, ob alles bei uns in Ordnung sei. Er hatte in seinem Gasthaus keine Ruhe mehr und so wollte er uns zu sich mit nehmen.
Das die Amerikaner schon am Rathaus standen, wusste er bereits.Und es war zu befürchten, dass diese mit Hausdurchsuchungen und Plünderungen bzw. Requirierungen begannen.Was aber später erst geschah.
Aber zuerst war es am 20.März 1945 verhältnismäßig ruhig. Dann kam ein Militärjeep die damalige Ludwigstraße herauf, dessen Besatzung in langsamer Fahrt in die Seitenstraßen und Höfe schaute.
Am 21. März, nachdem die meisten Panzer durchgefahren waren, fuhr plötzlich ein Jeep und ein Panzer wieder Richtung Jahnstraße, der Jeep fuhr weiter und der Panzer rollte in den Hof von Landwirt Jakob Ritter. Wir waren am Fenster von Opa Otto und sahen zu. Da wir ja noch nie einen solchen Panzer gesehen hatten, wollten wir natürlich an die Tür, die wir aber nur vorsichtig einen Spalt weit öffneten.
Der Panzerfahrer stellte den Motor ab, dann öffnete sich die Luke und heraus schob sich ein großer farbiger Amerikaner, der erste Farbige den wir in unserem Leben vor uns sahen. Sein Helm hatte auf beiden Seiten eine Antenne und auf der Brust hing vermutlich das Funkgerät.
Wir hörten wie er etwas rief, doch wir konnten ja kein Englisch. Dann griff er wieder nach unten und in seiner Hand hielt er Zigaretten, Schokolade und Kaugummi. Wir hatten ja in all der Zeit immer wieder gesagt bekommen... nichts nehmen, es ist alles vergiftet... Er deutete an, dass wir näher kommen sollten, was wir uns aber nicht trauten. Er merkte unser Zögern, dann warf er alles auf die Straße, zerbrach eine kleine Tafel Schokolade und aß selbst davon um uns zu zeigen, dass es essbar war. Wir fassten unseren ganzen Mut zusammen und hoben Zigaretten, Schokolade und Kaugummi auf, um dann schnell wieder zurück ins Haus zu kommen. Kurze Zeit später kam der Jeep mit dem vermutlich hochrangigen Soldat zurück und der Panzer drehte und fuhr ins Dorf zurück. Ich kann mich noch erinnern, dass wo einmal die gepflasterte Rinne war, kein Stein mehr zu sehen war. Alles aufgewühlt und die Pflastersteine eingedrückt.
Das war die erste Begegnung mit einem amerikanischen Panzer und seiner Besatzung. Was danach folgte, gehört zu einem anderen Kapitel, das „ Besatzungsmacht „ überschrieben werde könnte.
Ebbes iwwers Jerche ( Die Familie Jörg )
von Otto Ebling
Die Familie Jörg, die „Marietante und der Alfred“ wohnten in der Jahnstraße dort, wo heute die Bushaltestelle Jahnstraße ist.
Den Alfred kannte ich schon als kleiner Junge, denn er hatte auf dem alten Badeweiher einen Kahn und ein Holzfloß, dass wir, vor Angst es könnte untergehen nicht nutzten.
Nach dem Krieg, es war so um das Jahr 1948 ging ich mit 15 Jahren in den Sportverein Erfenbach, wo ich mit dem Geräteturnen begann.
Dort lernte ich auch den Alfred Jörg näher kennen. Wie haben wir Jungen gestaunt über den Alfred, der am Barren den Handstand machte, am Boden Überschläge und am Reck den Riesen. Für uns, wir waren damals etwa 50 junge Turner, war das eine Superleistung.
Wir wußten nicht, wie wir den Alfred ansprechen sollten. Einmal als Herr Jörg oder Vorturner Jörg. Doch die Lösung kam bald. Zu Beginn einer Turnstunde sagte dann Alfred folgendes: Für alle, die schon aus der Schule sind und arbeiten, bin ich der Alfred und für die Jüngeren bin ich der Herr Jörg, so lange bis wir uns näher kennen lernen und ich weiß, ob ihr beim Turnen bleibt.
Alfred war ein guter, aber stets sehr auf Haltung und Ausführung der Übungen achtender Vorturner. Ruhe und Ordnung in der Riege waren ihm wichtig. Er hatte auch keine Mühe damit, uns die Übung, wenn nötig 2-3 Mal vorzuturnen.Sein Sohn Edgar war kein so begeisterter Turner, er kam besser in der Leichtathletik zurecht. Aber sein großes Hobby war und blieb der Fußball. Allen älteren Erfenbacher ist es ja noch in Erinnerung, daß Edgar zu den besten Spieler der damaligen Zeit gehörte und so ist er heute noch auf vielen Meisterschaftsfoto zu sehen.
Nach der Turnstunde nahm Alfred mich zur Seite und fragte, ob ich ihm beim Transport der Getränke zum Sportplatz helfen könnte, und zwar immer sonntags bei einem Heimspiel der Fußballer. Da er aber nicht nur mich fragte, sondern auch Klein Willi und Ultes Adolf standen wir zu dritt da. Also ging ich sonntags schon früh zu Alfred, bevor die 2. Mannschaft spielte.
Ein kleiner Handwagen, zuerst ein Brett drauf, später war es ein Klapptisch und ein Hocker, mit dabei natürlich die Getränke wie Bier, Limo, Sprudel, Brezeln und Rauchwaren, das war alles was Alfred zu dieser Zeit hatte. Vor der alten Halle wurde aufgebaut und schon ging es los mit dem Verkauf. Dazwischen lief er rund um den Sportplatz um die Eintrittsgelder zu kassieren. Für das Geld hatte er eine Zigarrenschachtel und mit dabei einen kleinen Papierblock, um die aufzuschreiben, die kein Geld dabei hatten. Er vergaß keinen beim Kassieren. Auch ermahnte er die, die keines hatten aber beim nächste Spiel Geld mitzubringen. Ja, da hatte er noch eine selbstgeschriebene Preisliste so dass er, wenn viele Besucher kamen auch mal die Preise um 5 Pfennig erhöhte. Dann bekamen seine Helfer kostenlos auch eine zweite Limo.
Dann war da noch seine Frau Marie, von uns nur „Tante Marie“ genannt. Sie saß vor dem Spiel, wenn Alfred schon unterwegs zum Sportplatz war, in ihrem kleinen Kiosk beim Wohnhaus und verkaufte Getränke, Tabakwaren, Bonbons und Zuckerstangen. Mancher Erwachsene nahm sich schon auf dem Weg zum Sportplatz gleich eine Flasche Bier mit.
In diesen Jahren war der Besuch eines Fußballspieles noch ein Ereignis und der Sonntag war verplant. Eine anschließende Einkehr beim Steinmetz Otto oder in Eblings war etwas, das zum Programm gehörte.
Mittlerweile hatte der Alfred auf dem Platz seine Aufräumaktionen beendet und Papier und Kippen aufgesammelt. Besen, Schippe und Eimer waren stets dabei. Die Marietante saß noch so lange in dem kleinen Kiosk, bis die Sportplatzbesucher sich verlaufen hatten.
Wenn Alfred kam, wurde abgerechnet und am Abend, wenn das Wetter mitspielte, saßen beide auf der Bank gegenüber des Wohnhauses. An einer Stelle, die man auch den „ Alten Graben oder Bordegraben“ nannte.
Es kam aber auch öfters vor, daß „es Jerche“ am Sonntag oder Feiertags in ihrem Kiosk saßen, um an die Spaziergänger etwas zu verkaufen.
Es war für diese Zeit eine typisch „Owerdorfer“ Familie, mit der man in Freundschaft verbunden war.
De Berjer Peter (Der Peter vom Kirchberg)
von Otto Ebling
Mit seinem richtigen Familiennamen hieß er Peter Müller. Viele ältere Erfenbacher kannten in gut. Er wohnte auf dem Berg zusammen mit einer Schwester und zwei Brüdern. Die zwei Brüder Hans und Julius kamen nicht mehr aus dem Krieg zurück. Mit seinem Vater Johann und seiner Schwester Liesel bewohnte er drei Zimmer in einem kleinen Häuschen. Peter wohnte ebenerdig in einem kargen Zimmer. Da Peter nur wenige Meter unterhalb von uns wohnte, war er fast immer in unserer Nähe, wo für ihn immer auch etwas zum Essen übrig war.
Peter war in seiner Jugendzeit in verschiedenen Heimen, da sein Vater alleinstehend war und seine Mutter in Kaiserslautern lebte und sich nicht mehr um die Kinder kümmerte.
Für eine feste Arbeit konnte man Peter nicht anstellen, da er geistig leicht behindert war. Da er aber in den Heimen stets in einer Gärtnerei arbeitete, hatte er gute Kenntnisse von Blumen und Sträuchern. Um das Haus auf dem Berg wuchsen Flieder und Holunder sowie Schlehen. Peter pflegte die Sträucher und ging, wenn der Flieder blühte, mit einem Arm voll Flieder zu den Leuten, immer in der Hoffnung, dass er etwas zu Essen oder eine Zigarre bekam
Im Winter, wenn er alle seine Topfblumen im Zimmer hatte, wo er auch schlief, ging er jeden Abend mit der Gießkanne durch den Raum und goss die Blumen. Dass der Boden dabei nass wurde, störte ihn nicht.
Peter hatte aber noch ein Hobby. Schon lange vor Weihnachten suchte er seine Krippenfiguren zusammen und baute sie im Zimmer zusammen.Er baute dort, wo gerade Platz war. Einmal war diese Krippe auf dem Tisch, ein anderes mal auf dem Boden. Aber immer wurde die Krippe mit allerhand zusätzlichen Zweigen, Steine und Moos verschönert. Die Krippenfiguren wurden vorher in einem Eimer gewaschen und auf der Fensterbank getrocknet. Dass die Figuren allmählich ihre Farbe verloren, störte Peter nicht. Es war halt eine Naturkrippe und Peter freute sich daran auch weit über die Weihnachtszeit hinaus.
Wenn man am Fuße des Weges steht, der zu den Häusern am Berg führt, kommt man an einem kleinen Brunnen vorbei. Der wurde schon zu Lebzeiten von Peter als das Peterbrünnchen benannt, da er sich auch dort um die Blumen, die den Brunnen schmückten, kümmerte.
Wir holten Peter oft, wenn wir viele Mäuse im Haus hatten. Im Mäuse fangen war Peter sehr geschickt, er setzte sich vor das Mauseloch und sobald eine Maus auftauchte, schlug er mit der Hand zu.
Oft sah man Peter auch mit einem Zettel und Bleistift, wenn er von den Bauern den Auftrag bekam das Vieh zu zählen. Dies tat er dann mit großem Eifer.
Mit seinem Vater verstand er sich nicht besonders gut und so rief er uns öfter zu Hilfe, wenn sein Vater ihn schlug. Aber er rettete seinem Vater auch das Leben, als dieser nicht von der Nachtschicht auf der Lampertsmühle nach Hause kam. Sein Vater war auf dem Weg von der Gottliebshöhe im Schnee gestürzt und hatte das Bewusstsein verloren. Peter kam zu uns und rief: „De Vatter iss noch net do, mer missene suche geh.“ Wir fanden den Johann dann schon fast zu Eis erstarrt am Waldesrand. Aber er kam doch wieder zu sich und wir geleiteten ihn nach Hause, wo er sofort zum aufwärmen ins Bett gesteckt wurde.
Auch ein weiteres mal konnte Peter seinem Vater aus einer misslichen Lage helfen.
Früher stand fast immer das „stille Örtchen“ ein Stück vom Wohnhaus entfernt. Durch den vielen Regen damals saugte sich der Hang mehr als sonst mit Wasser voll. Die schweren Fliederbüsche zogen dann das Erdreich weg und der Steilhang rutschte hinunter auf den Pfad zum Wohnhaus. Da das Klo nahe an der Hangkante stand, wurde es auch mitgerissen. Peters Vater war im Plumpsklo gefangen und lag etwa 10 Meter tiefer im Gebüsch. Seine Hilferufe wurden von Peter gehört und sofort wollte er helfen, kam aber nicht den Hang hinunter. Also rief Peter laut um Hilfe. Alles was helfen konnte eilte herbei. Da die Tür auf der Seite eingeklemmt war, musste man sie eintreten und so konnte der Johann aus dem Gewirr von Flieder befreit werden. Etwas lädiert, aber sonst wohlauf, zog man ihn dann wieder hoch auf festen Boden, wo er sich bald von dem Schreck erholt hatte.
Der Peter war auch eine gute Seele, denn er wusste ja, dass mein Bruder und ich ebenfalls mit der Mutter allein lebten, da der Vater im Krieg war und nicht mehr lebend nach Hause kam, er half auch bei uns im Garten mit, wenn es für uns Kinder zu schwer war.
Heute ruht Peter auf dem Friedhof in Erfenbach.
Erlebnisse zu Zeiten der „Alten Bachbahn“
von Otto Ebling (geb.1933)
Meine ersten Erlebnisse und Erfahrungen mit der Bachbahn waren in den letzten Kriegs-und Nachkriegsjahren. In den Jahren 1944/1945 war ich an Diphtherie und an einem Ohrenleiden erkrankt und zu dieser Zeit war auch kein Arzt in der näheren Umgebung erreichbar. Und so mussten wir zur Impfung und Ohrenbehandlung nach Kaiserslautern fahren. Der Zug kam schon mit Verspätung an und bestand aus 2 oder 3 Personenwagen, die schon randvoll mit Bauern belegt waren, die mit Federvieh, Körben mit Feldfrüchten, Käse oder Butter auf dem Weg zum Markt waren. Dazwischen hatte der Zug zwei Güterwagen, die notdürftig als Personenwagen umgebaut waren. Das bedeutete, in diesen Wagen gab es nur an den Längsseiten Sitzplätze aus Holz, die noch nicht einmal gehobelt waren. Haltegriffe waren nur als Seilschlaufen an der Decke angebracht und für mich nicht erreichbar. So standen wir bis nach Kaiserslautern an den Seitenwänden der Tür, wo es furchtbar zog.
Die Fahrt zum Westbahnhof dauerte mehr als eine halbe Stunde. Dort angekommen wurde man noch an der Ausgangssperre kontrolliert,was nochmals viel Zeit in Anspruch nahm. Am Anfang der Mühlstraße standen dann noch Polizisten und fragten nach dem woher und wohin.
Da nach dem Arztbesuch kein Zug mehr vor dem Abend zurück fuhr, mussten wir zu Fuß vom Schillerplatz aus über den Wiesenthalerhof nach Hause laufen.
Im Jahr 1948 am 2.August begann um 7.00 Uhr mein erster Arbeitstag bei der Fa. Pfaff. Der erste Zug aus Richtung Reichenbach kam kurz nach 6.00 Uhr am Morgen.Umgebaute Güterwagen gab es keine mehr am Zug, aber die Personenwagen waren ausgediente Wagen mit schlechten Holzbänken, keine Toiletten, die Türen und Fenster schlossen nicht mehr fest und die Plattformgitter ließen sich nur sehr schwer öffnen oder standen immer offen. Der Zug hielt in Otterbach, die Lokomotive bekam ihr Wasser oder Kohlen und weiter ging es Richtung Kaiserslautern bis zum Westbahnhof, der ein Sackbahnhof war. Die Einfahrt ging recht langsam, da das Gleisbett unter den Rädern sehr nachgab. Das Bahnhofsgelände war ja im Krieg zerstört gewesen und nur notdürftig instandgesetzt. Aber es gab bereits wieder eine Schalterhalle mit Fahrkartenausgabe und einen kleinen Wartesaal. Die Gepäckabfertigung funktionierte ebenfalls schon und man konnte über die Rampe wieder ein-und ausladen. Schalterraum und Ausgangssperre zur Straße hin waren nur provisorisch und einfach eingerichtet. Ich weiß noch, dass bei starkem Regenwetter das Wasser vom Dach über den Bahnsteig lief und sich im Gleisbett sammelte. Die Drehscheibe zum Auswechseln der Lokomotiven auf ein zweites Gleis war in dieser Zeit noch nicht möglich, so das der Zug zurücksetzen musste bis zur Drahtfirma Hemmer, wo die nächste Weiche war. Da ich zu dieser Zeit ja noch keine Ahnung hatte, wie ich zum Pfaffwerk kommen sollte, schloss ich mich der Mehrheit der Leute an, die in Richtung Mühlstraße und Kotten gingen. Es ging über die wieder hergestellte Kottensteige zum Sedansplatz und ich erreichte noch vor 7.00 Uhr meinen ersten Arbeitsplatz.
Die nicht ganz so schönen Erlebnisse fingen bereits in Erfenbach an. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir einen Stationsvorsteher mit Namen Werth. Der gute Mann machte seinen Dienst ganz nach Vorschrift wie ein preußischer Beamter. Denn wenn man, so wie ich einmal keinen aktuellen Nachweis über die Beschäftigung bei der Fa. Pfaff hatte, zum Beispiel wenn man mal krank war oder Urlaub hatte, rückte er keine Wochen-oder Monatskarte heraus, obwohl er wusste, dass ich meine Unterlagen bei ihm zum Arbeitsanfang abgeben musste.Die Fahrgäste ließ er oft erst dann auf den Bahnsteig, wenn der Zug nach Abfahrt am Siegelbacher Bahnhof Signal gab. Oft ließ er uns auch nicht in den Wartesaal, auch wenn es sehr kalt war und das mit der Begründung, der Fußboden würde jeden Tag so schmutzig sein. Doch man muss auch zugestehen, dass in dieser Zeit viel geraucht wurde und die Leute ihre Zigarettenkippen auf dem Boden austraten, oder auf den Boden spuckten. Es gab auch Tage im Winter, wo er telefonisch verständigt wurde, dass der Zug in Reichenbach stand und die Leitungen eingefroren waren. Dann sagte er uns, dass wir auf dem Gleis nach Otterbach laufen sollte, er hätte mit dem dortigen Stationsvorsteher gesprochen, der dann den Zug aus dem Lautertal etwas länger stehen ließ. Aufgepasst hat er wie ein Luchs, ob niemand von der anderen Schienenseite aus Richtung Stockborn den Zug bestieg. Das fahren ohne Karte ging fast immer schief, denn auf der Strecke wurde mindestens zweimal kontrolliert: einmal vor Otterbach und ein- bis zweimal zwischen Otterbach und Westbahnhof. Ab Bahnhof Otterbach wurde ständig kontrolliert, da ja Fahrgäste, die aus dem Zug „Kälbertal“, so wurde der Zug von uns genannt, kamen, meistens dort umstiegen. Verspätung hatte unsere Bachbahn fast immer. Das lag dann im Winter oft daran, dass trotz der Kälte zu spät eingeheizt wurde oder die Bremsschlauchverbindungen vereist waren. Dann ging stundenlang gar nichts mehr auf dieser Bachbahnstrecke.
Es war, so glaube ich noch zu wissen, in den fünfziger Jahren, als dann der Haltepunkt Pfaffwerk eingerichtet wurde und der Zug vom Westbahnhof kommend diesen Haltepunkt anfahren konnte. Gleich in dem nächsten Winter danach passierte dann folgendes:
Der Zug fuhr rückwärts aus dem Westbahnhof und wollte langsam den Aufstieg zwischen dem Drahtwerk Hemmer und der „Alten Brücke“ anfahren, jedoch war der Gleisabschnitt zwischen den steil aufragenden Felsen derart zugeschneit und vereist, dass die Räder keinen Halt mehr auf den Schienen fanden. An Streuen war nicht zu denken und so ging es rückwärts bis der letzte Wagen kurz vor der Autobahnbrücke stand. Mit einem erneuten Anlauf und mit mehr Dampfdruck schaffte es der Lokführer bis auf die Ebene hinter der „Alten Brücke“. Das passierte ein oder zwei Jahre später noch einmal. Dieses mal mussten alle Fahrgäste hinter dem Drahtwerk Hemmer aussteigen und zurücklaufen bis dahin, wo heute der Haltepunkt Westbahnhof ist. Man forderte eine zweite Lokomotive an, was dann eine Weiterfahrt mit mehr Kraft möglich machte. Da viele Pfaffianer an diesem Morgen unverschuldet zu spät kamen, wurde kein Lohn einbehalten.
Eine letztes Ereignis, das mich selbst betraf, kam Jahre später. Diesmal war ich mal wieder morgens spät dran und so hörte ich den Zug bereits in den Bahnhof einfahren. Ich war etwa in Höhe des alten Friedhofs. Es war im Winter und stockdunkel und so rannte ich los. Als der Zug auf seiner ganzen Länge aus dem Bahnhof war, sah ich im Dämmerlicht gerade noch die Plattform vom zweitletzten Wagen, sprang auf das untere Trittbrett, übersah aber dabei, dass das Gitter geschlossen war. Ich prallte mit voller Wucht an das Gitter, hielt mich aber an dem linken Bügel fest und zog das andere Bein nach oben, wo ich dann Halt fand. Nach der ersten Schrecksekunde konnte ich das Gitter öffnen und stand auf der Plattform. Erst in Otterbach war ich in der Lage in das Abteil zu gehen, wo die Erfenbacher mich fragten, wo ich denn jetzt herkäme. Mein Schaden war: eine zertrümmerte Thermoskanne und ein zerbeultes und ausgelaufenes Essenskännchen. Da hatte ich wieder einmal Glück gehabt und so fuhr ich noch viele Jahre mit der guten alten Bachbahn. Das änderte sich erst als die DB- Busse am Rathaus in Erfenbach abfuhren.
So war die Erfenbacher Kerwe in meiner Erinnerung vor 80 Jahren
von Otto Ebling
Ja, erinnern kann ich mich noch so ab dem Jahre 1937. Für uns Kinder gab es ja in dieser ärmlichen Zeit an Höhepunkten im Jahr nur Weihnachten, den Geburtstag und Ende August die „Kerwe“. Man freute sich stets schon in der zweiten Augusthälfte auf die Ankunft der „Reitschule“, die von der Familie Krebs aus Siegelbach im Unterdorf aufgebaut wurde. Einige Tage vor dem Kerwewochenende wurden schon die ersten Wagen gebracht und rings um den damaligen Bauernhof Heil, im Kinderschulweg, sowie im Hof vom Bauern Schermer abgestellt. Die bunt angemalten Buden und Wagen zogen sogleich unsere ganze Aufmerksamkeit an. Gutsjeständsche , Karusell , Schiffschaukel und Schießstände“ waren sofort von uns in Beschlag genommen, denn jeder wollte ja sehen, was alles aufgebaut wurde.
Für uns war es eine Freude dabei zu sein. Zu Hause hatten die Hausfrauen mehr Arbeit als sonst, denn die „liebe Verwandtschaft“ aus der näheren Umgebung hatte sich schon seit Wochen vorher zum Kaffee angemeldet.Denn Ende August gab es schon die ersten Zwetschgen und da musste unbedingt Zwetschgenkuchen oder auch Streuselkuchen auf dem Tisch stehen.
Wenn dann der Kerwesonntag endlich da war und man festlich gekleidet, die Buben mit Anzug und die Mädchen mit Schleifen in den Haarzöpfen, dem Nachmittag entgegen fieberte, verging die Zeit dann viel zu langsam. Doch bevor man zum Kerweplatz ging, wurde an den Gasthäusern der „Kerwestrauß“ aufgesteckt.Die Straßen waren voll von Einheimischen und Gäste, von denen viele aus Siegelbach , Otterbach , Sambach und vom Wiesenthalerhof kamen. Dann zogen die „Straußborch“von Blechblasmusik begleitet zu den Gastwirtschaften, wo dann der „Strauß“ aufmerksam begutachtet wurde. Mit dem fast überall zu hörenden Ruf „Straußborch , wemm iss die Kerwe“ und der daraus entstehenden Antwort „Unser“ begannen die „Kerweredde“.
Wenn man etwas später hinzukam,und weiter entfernt stand, war fast von der Rede nicht mehr viel zu hören , so groß war der Lärm der vielen Menschen, die die Rede mit Kommentaren und Gelächter begleiteten. Meistens begann das Spektakel am Gasthaus „Zur Waldeslust“ bei Weißmanns. Dann folgten das Gasthaus „Zum grünen Baum“ in der damaligen Ludwigstraße, das meinem Großvater Otto Ebling gehörte. Danach zog man ins Unterdorf zum Gasthaus „Zum Ochsen“ bei „Hache“. Da ja alles , was so in Erfenbach über das Jahr geschah von dem „Kerwegretche“ vorgetragen wurde und man sich nach der ersten Kerwerede zur nächsten durchwursteln musste, kam man meistens zu spät hinzu. Zum „Haasevetter“ und ins Eck zum „Ecker Johann“ brauchte man dann schon nicht mehr hin , um dort die Kerwerede zu hören, denn dort waren schon die ersten 3 Tänze, die den „Straußborch“ vorbehalten waren, vorüber.
Uns Kinder interessierte aber von diesem Zeitpunkt an nur noch eins, “Die Reitschul“. Pferde, Kutschen, Schwäne und Autos zogen uns magisch an. Das Kettenkarusell, das wir aber nicht alleine fahren durften , war zu verlockend. Mein Vater nahm mich mit auf die Schiffschaukel, wo ich mich dann auf den Boden des Kahnes setzte und so auch mitschaukeln konnte. Ganz wild war ich auf die Stände mit den „Gutsjer“ (Bonbon ). Es gab Himbeergutsjer, Zuckerstangen, Lakritze Schokoladezigaretten,Waffeln und vieles mehr. Die Bruchwaffeln in den Tüten waren besonders billig und so bekam man auch mal zwei davon. Nach Jahren hatte ich einige faule Zähne im Mund und der „Bader „Herr Scherer“ sagte mir immer wieder, das kommt nur von deinem „Schnäkes“ also von zu vielem Süßzeug. Da man ja fast das ganze Jahr über davon nichts, oder nur wenig bekam, machte man an solchen Kerwetagen reichlich Gebrauch davon.
Jahre später, als ich dann 7 oder 8 Jahre alt war, durften wir Buben auch schon mal beim Aufbau der Reitschule mithelfen. Wir legten die Bodenbretter aus und der Sohn von der Familie Krebs, ich glaube er hieß Hans, schraubte diese dann fest. Wir bekamen dann Freikarten und so konnten wir ohne Bezahlung einige Runden drehen. Die größeren und stärkeren Buben durften auch schon mal helfen das Karussell anzuschieben. Manchmal wurde auch ein Esel vorgespannt.
Am Schießstand durfte ich dann, mein Vater hielt das Gewehr, die Hände an den Schaft halten und da ich ja zu klein war, tat ich so als würde ich zielen, natürlich petzte ich dabei auch ein Auge zu. Manchmal erhielt ich , obwohl ich vorbei schoss , auch eine Blume. Da die „Erfenbacher Kerwe“ immer drei Tage dauerte , nahm sich mein Vater ins „Herr Paffe“ Urlaub und so waren wir jeden Tag auf dem Kerweplatz. Anschließend ging es zum Großvater Otto,wo ich dann eine Tüte Brezeln und Limonade bekam. Dort traf mein Vater ja immer Bekannte , dann dauerte dieser Wirtschaftsbesuch auch mal etwas länger. Da mein Vater ja ein Sohn des Hauses war, musste er auch des öfteren beim Ausschank mithelfen und stand stundenlang am Zapfhahn. Für mich war das ja so langweilig, so dass Oma „Sanche“ Mitleid mit mir hatte und ich mich bei ihr auf dem Sofa ausruhen durfte und vor Ermüdung einschlief.
Etwas besonderes gibt es auch noch zu berichten. Vor dem Krieg waren wir meistens am zweiten Kerwetag bei unseren Verwanden bei Müllers „Im Eck“, dort trafen wir fast immer das „Schachtelmännchen“. Ein etwas älterer und schrulliger Mann, der für die Kinder Windröschen aus Papier oder kleine Kartonschachteln herstellte. Er bekam dann 5 oder auch mal 10 Pfennige für seine Kunststücke. Essen und Trinken bekam er in der Gastwirtschaft umsonst. Sein Standort war meistens die Mauerecke hinter Schaumlöffels Haus. Heute steht eine Steinfigur von ihm gegenüber des Storchenturms in Kaiserslautern.
Wir waren nicht nur auf unserer Kerwe, wir gingen auch zu Fuß über den „Paffenberg“ durch den Wald hinauf „Uff die Hitte“(Erzhütte), wie man damals so sagte. Ins „Koche Gasthaus“ wurde dann eingekehrt , wo man im Biergarten herrlich sitzen konnte. Der Weg ging zu dieser Zeit durch dichten Kiefernwald und man war froh , sich dann ausruhen zu können. Der letzte Rastplatz auf dem Heimweg war dann das Brünnchen , heute der Tannenbrunnen. Einen großen Teil des Weges wurde ich auf dem Rücken meines Vaters „gekorzelt“, in Erfenbach war dies der Ausdruck für „Auf dem Rücken getragen“. Besonders lang war immer der Weg zum „Kreizhof“ (Kreuzhof).Denn zum Kreuzhof und wieder zurück ging es ja fast immer bergauf. Dann war ich immer hundemüde und jammerte es auch meinen Eltern vor.
Gegen Ende der 40er Jahren steckten wir junge Burschen dann den Strauß bei meinem Großvater auf. Damals machte ich den Mundschenk und reichte dem „Kerwesepp“ den Wein auf die Leiter. Da wir in den Jahren danach zu arbeiteten anfingen und man keine Zeit mehr zum „Knibbeln“ des Straußes hatte, schlief die ganze Sache dann ein und in „Eblings“ gab es keine Kerwerede mehr.
Zu dieser Zeit gab es im Oberdorf zwei Gasthäuser, Weißmanns und Eblings. Im Unterdorf waren es Hach, Haas, Theodor Müller und Johann Müller im Eck, wo noch der Kerwestrauß aufgesteckt wurde. Ein Gasthaus gab es auch auf der Lampertsmühle, deren Namen mir entfallen ist.
Ja, dann kamen die Kriegszeiten und der Brauch schlief etwas ein. Vielleicht auch deswegen, da unsere jungen Männer bereits im Krieg waren und das Kerwefeiern durch viele andere Ursachen den eigentlichen Sinn für Spaß und Freude verlor und andere Gedanken vorherrschten. Doch nach 1948 fing die Jugend, aber auch die älteren Semester, wieder mit viel Schwung daran, diesen Brauch wieder ins Leben zu rufen und so geht es bis zum heutigen Tag wieder weiter mit dem Ruf „Straußborch, wemm iss die Kerwe“
Die Zeiten haben sich geändert, aber die Tradition besteht immer noch und auch die jungen Frauen mischen jetzt so richtig mit.
Von Oberauerbach nach Erfenbach - Die Geschichte eines Wanderstockes
von Otto Ebling
Diese Begebenheit über einen Wanderstock wollte ich schon immer mal niederschreiben, um sie für die Familie am Leben zu erhalten.
Es war im Jahre 1939 als der Wanderstock von Oberauerbach auf die Reise nach Erfenbach ging.
Mein Vater war als Sanitäter, nach der Musterung und einer kurzen Ausbildung in der 23er Kaserne in Kaiserslautern, nach Oberauerbach -dieser Ort gehört heute zu Zweibrücken- verlegt worden. Da er zusammen mit noch einigen Kameraden aus Erfenbach direkt in eine Sanitätskompanie kam, wurde die militärische Ausbildung vom Sanitäter zum Soldat dort fortgesetzt. In dieser Zeit bekamen die Soldaten, da sie ja noch in der Heimat waren, jedes Vierteljahr Kurzurlaub.
So erfuhren wir, dass die Familie ihn dort auch besucht konnte, allerdings musste ein Besuchsantrag gestellt werden und es war nur für einen Tag.
Ich kann mich noch, mit meinen damals 6 Jahren, an diese Besuche erinnern und da wir ja schon vieles über die Westfront und den Westwall gehört hatten und auch wussten, war das Interesse, den Vater dort zu besuchen, groß.
Für uns Buben gab es 1939 mehrseitige Hefte zum Sammeln, die 1 Reichsmark kosteten. Es waren Bilder und Texte von allen Waffengattungen, z.B. Luftwaffe, Marine und Panzer-und Grenadiereinheiten darin. Auch ich hatte daran Interesse gefunden und so erfuhr ich vieles über die damalige Deutsche Wehrmacht und deren Entwicklung. Vor allem die bunten Bilder in den Heften hatten eine große Anziehungskraft und die Texte konnte ich zu dieser Zeit auch schon lesen.
Meine Mutter und ich erhielten dann die Besuchserlaubnis mit genauem Datum und Uhrzeit und an diesen Termin musste man sich dann strikt halten.
Ein guter Bekannter von uns, von mir nur Onkel Henrich (Heinrich Mertel) genannt, bot sich an uns zu begleiten. Denn noch niemals waren wir aus unserem kleinen Erfenbach so weit heraus gekommen. Also ging es früh am Morgen zum Hauptbahnhof nach Kaiserslautern und weiter nach Zweibrücken, wo wir am Vormittag ankamen.
Da standen wir nun, denn eine weitere Fahrmöglichkeit gab es von dort aus nicht. Wir erkundigten uns nach dem Weg nach Oberauerbach und marschierten los. Für mich war dies ein weiter Weg und so kam es, dass Onkel Henrich mich auch ein paar mal auf den Schultern tragen musste. Es war schon Mittag als wir das Militärgelände erreichten. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass wir am Tor warten mussten und nach unseren Erlaubnispapieren gefragt wurden. Nach längerem Warten wurde der Vater gerufen und mich hat erstaunt, dass er uns mit Sanitätssoldat Ebling vorgestellt wurde. Er bekam für einige Stunden frei und so suchten wir zuerst die Baracke, in der er mit seinen Kameraden wohnte. Wir durften uns aber nur in einem begrenzten Raum um die Baracke aufhalten. So wie ich mich noch daran erinnern kann, lag das Barackengelände in einem Tal, das von Wald umgeben war. In der Nähe musste der Schießplatz gewesen sein, denn man hörte die ganze Zeit Gewehrschüsse.
Nun zu dem noch heute vorhandenen Spazierstock aus Oberauerbach.
Mein Vater hatte in seiner Freizeit aus einer kleinen Tanne, mit einer Wurzel, die wie ein Krokodil aussah, einen Gehstock kunstvoll geschnitzt.
In die Rinde schnitt er die Worte: „Westfront-Oberauerbach 1939“, dann das Eiserne Kreuz, sowie seinen Namen Albert Ebling. Er sagte, diesen Stock nehmt ihr mit nach Hause. Wenn man bedenkt, dass diese kleine Tanne damals vielleicht 6-8 Jahre alt war, so ist dieser Gehstock heute 84 Jahre alt, so alt wie ich heute bin. Vielleicht auch noch etwas älter. Das Krokodil als Knauf hat zwar zwei Füße verloren, aber seine grüne Farbe von damals hat es heute noch und der Wanderstock hängt bei uns als Erinnerung an einer Wand.
Es ist ein Andenken an eine Zeit, in der man sich als 6 Jähriger noch keine Gedanken über die Zukunft machte. Denn mein Vater wurde kurze Zeit später von Oberauerbach aus direkt an die Lothringische Grenze verlegt und von dort aus in das Kampfgebiet nach Frankreich. Nach einem kurzen Urlaub kam die Sanitätskompanie von Bad Sobernheim an die Polnische Grenze und weiter in den Nordabschnitt nach Russland. Mein Vater kam dann in den Jahren 1941-1943 noch einmal pro Jahr für 3 Wochen auf Urlaub. Im Jahre 1944 erhielten wir die Nachricht, dass er als vermisst galt. Im Jahre 1946 kam ein Russlandheimkehrer aus Otterbach und überbrachte uns persönlich die traurige Nachricht, dass der Vater im Ort Petrakofskaja in der Gefangenschaft verstorben sei.
Normalerweise wäre ich ja 1939 in die Schule gekommen, aber bei dem Einschulungstermin wurde mir vom Schulrat gesagt, der ist ja noch viel zu klein, er soll noch ein Jahr warten. Ich war ja auch noch zu schwach, um den Ranzen zu tragen Also ging es erst 1940 zur Schule.und damit kam für mich die erste Veränderung von den Kleinkindertagen zu den Pflichten des Alltags. Ich hatte dann auch meine Beschäftigung, denn mein Großvater Otto kam des öfteren zu uns und dann hieß es ab in den Wald zum Holz holen. Er sagte dann immer: Dein Vater ist jetzt nicht da und darum musst du den Vater bei der Arbeit im und ums Haus ersetzen. Nach der Schule musste ich auch auf dem Bauernhof von Emil Heil, der ein Verwandter von uns war, mithelfen. Ganz stolz ging ich dann gegen Abend mit der vollen Milchkanne oder auch mit ein paar Eiern nach Hause. Im Scheine der Tischlampe musste ich auch noch meine Schularbeiten machen und so saß ich des öfteren mal bis 20.00 Uhr beim Schreiben und Rechnen. Denn damals war ja noch „Schönschreiben“ angesagt. Dann war ja auch noch die Arbeit in unserem großen Garten, wo ich so manchen Eimer mit Wasser zu den Beeten schleppte. Zum Spielen mit meinen Schulkameraden blieb wenig Zeit und auch das Einkaufen war meistens meine Aufgabe. Aber da wäre noch so manches über diese Jahre zu berichten. Vielleicht einmal später.
Erinnerungen meines Vater Otto Ebling und von mir an den "Badeweiher"
Über Wald-und Wiesenpfade zum Badeweiher
von Otto Ebling
Im Jahre 1937 wohnten wir zu Miete im Haus Nr.1 in der Hirschdell bei Familie Merkel. In dieser Zeit standen in der Hirschdell nur 2 Häuser, von Familie Lackmann und Familie Merkel. Dahinter begannen die Felder und die Hirschwiesen, in denen die Hirschquelle sprudelte, die auch heutzutage noch Wasser führt, aber an die Kanalisation angeschlossen ist. Von Merkels aus ging es auf einem mit Kopfsteinen gepflasterten Feldweg steil hinauf in Richtung Sauerberg. Der Weg trennt die Gewannen Kohlenberg links und Sauerberg rechts. Ein steiler Pfad, der heute zugewachsen ist, führte durch den Wald bis zu einem Querweg, der von Invaliden hergerichtet wurde. In Erfenbach wird es das „Invalidenpädchen“ genannt. Unten angekommen, traf man auf einen Holzabfuhrweg, der entlang des Badeweihers führte. Man querte den Waldweg und stand am Tor des Schwimmbads, dass damals noch fast im Wald lag. Lediglich eine Fläche war für den eigentlichen Weiher gerodet worden. Kein Erfenbacher sagte in dieser Zeit „wir gehen an den Pfaffenwoog“, es war ganz einfach „De Badeweiher“. Im Wasser sah man damals noch vereinzelt die Baumstümpfe, denn auf der linken Seite ragte der Wald noch an den Uferrand heran und rechts standen alte Birkenbäume und mannshohes Gebüsch. Das hatte aber wiederum den Nachteil, dass bei einem Sturm auch mal ein Baum über dem Waldweg lag und die Äste in die Anlage ragten. Ein Vorteil war, dass die größeren Buben diese Stämme entasteten und auf das Wasser zogen, wo sie dann 3 bis 4 Stämme zusammenbanden und als langes Floß nutzten. Ging man über den Weiherdamm, kam man zu einer kleinen Hütte, die gleichzeitig als Umkleidekabine diente und auch als Toilette die daran angebaut war. Jahre später wurde die ganze Anlage vergrößert und neu gestaltet.
Erinnern kann ich mich noch an einen Kahn, der von Alfred Jörg gesteuert, auch Badegäste über den Weiher paddelte. Das Wasser, dass den Badeweiher speiste, kam vom Erfenbach, der durch den Weiher floß. Sehr kalt, aber auch sauber und trinkbar war das Wasser vom Bach. Alfreg Jörg hatte dafür gesorgt, dass man in einem kleinen Becken das Wasser sammelte und man mit den Händen daraus trinken konnte. Der Weiher hatte damals noch nicht die Größe und Tiefe wie Jahre später. In südlicher Richtung war er schmaler und das Wasser nur etwa knietief. Da ich mit meinen Eltern abends oder am Wochenende dort war, durfte ich, an der Hand meines Vaters, am Einlauf des Erfenbachs immer quer durch das Wasser laufen, das mir dann bis zur Brust reichte. Mein Vater konnte gut schwimmen und meine Mutter saß mit mir am Ufer und wir schauten zu. Viele Erfenbacher konnten in dieser Zeit nicht schwimmen und es waren immer nur wenige im Wasser. Aber der Badeweiher war ein beliebter Treffpunkt für die Erfenbacher und so war die Anlage immer gut besucht. Hinter dem Badeweiher waren kleine Becken für eine Fischzucht angelegt und wenn es stark regnete, liefen die Becken über und man fand im Badeweiher kleine Fische.
Alfred Jörg war der Mann für „Alles“, der gute Geist des Schwimmbades. Auf dem Weg zum Badeweiher hatte er eine Schaufel und Astschere dabei, womit er den Weg und die Stufen säuberte und die Brombeerhecken kurz hielt. Vor dem Einlauf des Erfenbachs zum Weiher lag ein Schilfgürtel, den er mit einigen arbeitslosen Männern stets freischnitt. Er kontrollierte das Wasser auf Sauberkeit und fischte Blätter und Äste ab. An der Umkleidekabine hing er eine Tafel auf, wo er Luft-und Wassertemperatur mit Kreide anschrieb.
Vor allem, und das war ihm eine Herzensangelegenheit, lehrte er die Kinder schwimmen. (aber auch manchen Erwachsenen) Mit einer langen Stange, an deren Ende er eine Seilschlinge befestigt hatte, die die Schwimmschüler umbekamen, sprang er am Ufer entlang und gab die Kommandos wie Arme und Beine zu bewegen waren. Merkte er, dass ein Kind keine Kraft mehr hatte, sprang er mit der Stange ins Wasser und zog damit das Kind an Land. Es war schön zuzuschauen, wenn er sich auf den Boden legte und Trockenübungen vormachte, dazu rief er immer mehrere Nichtschwimmer zusammen. Das machte er einige Minuten und dann ging es ins Wasser. Er war stets hilfbereit und wenn er merkte, dass Behinderte oder kleine Kinder ins Wasser wollten, half er ihnen dabei und hatte ein wachsames Auge auf sie. Alfred Jörg war aber auch sehr auf die Sauberkeit des Schwimmbades bedacht. Bemerkte er, dass jemand etwas fallen oder liegen ließ, war er sofort zur Stelle mit den Worten: „Darfst du zu Hause auch, alles fallen und liegen lassen? Hebe es gleich wieder auf“, ermahnte er denjenigen.
Es kam die Zeit, wo man am Badeweiher auch Änderungen vornahm. Die Einfriedung entlang der Straße wurde erweitert und der Eingangsbereich neu gestaltet. Die Steinböschung am Abfluß (Weiherdamm) wurde seitlich etwas erhöht und verbreitert, so dass die Uferböschung nicht mehr unterspült wurde und man die Wassertiefe an der „Schließ“ genauer regulieren konnte. Das alles unter den wachsamen Augen eines Mannes, der nur für den Badeweiher da war.
Im Jahre 1938 zogen wir von der Hirschdell 1 auf den Kirchberg, in das Haus „Am Berg 5“, das etwa 90 Meter höher lag, als die damalige Ludwigstraße und nur über einen Treppenweg und Pfad erreichbar war. Von dort aus mußten wir uns überlegen, wie wir auf kürzestem Weg zum Badeweiher kamen. Wir fanden einen kurzen Weg, indem wir zur Dammstraße (heute Kindergartenstraße) gingen, wo das Wasser der Hirschquelle und vom Wasserhaus, das auch die kleine „Weschbach“ beim „Guts Adam“ durchfloß, in der Dammstraße offen die Straße querte. Es entstand eine kleine Furt, und nahe des Hauses Müller/Mangold war ein aus einer Sandsteinplatte bestehender Übergang errichtet worden. Weiter ging es zum Schulgarten und über Äcker und Wiesen bis zum Garten der Familie Motz und steil hinab zum Waldweg am Badeweiher. Vor- und einige Zeit während des Krieges war ausser dem Kahn noch ein rechteckiges Floß auf dem Wasser, dass man hin und her ziehen konnte. Ich wollte doch auch Schwimmen lernen, um sicher auf dieses Floß zu gelangen. Leider wurde es mir von meiner Mutter untersagt. Aber ich hatte eine Ausrede, um doch an den Badeweiher zu dürfen und sagte: Ich gehe nur an den Badeweiher um mich mit meinen Schulkameraden zu treffen oder fahre mit dem Kahn mit. Das war dann so in Ordnung und ich durfte dort hin.
Es war schon in den ersten Kriegstagen als Werner Motz und Karl Neurohr das Floß ans Ufer zogen, ich darauf kletterte und sie es wieder ins Wasser zogen, nicht ahnend, dass ich nicht schwimmen konnte. Mit meinen nassen Füssen rutschte ich auf dem Floß aus und lag im Wasser. Die beiden bemerkten dann zum Glück sofort, dass ich nicht schwimmen konnte, sprangen mir nach und halfen mir wieder auf das Floß. Bei mir war der Schreck so groß, daß ich mich nicht mehr ins Wasser traute, so das ich von dieser Zeit an nicht mehr zum Schwimmbad ging. Erst als Erwachsener lernte ich zuerst quer über den Weiher zu tauchen, dann später auch das Schwimmen.
Auch im Winter war der Badeweiher für uns Buben ein Treffpunkt. Im Herbst wurde ein Teil des Wassers zur Reinigung des Weihers abgelassen, so dass im oberen Teil nur noch eine Wassertiefe von ca. fünfzig Zentimeter vorhanden war. In den Jahren 1940 bis 1943 waren es kalte und schneereiche Winter. Es bildete sich eine dicke Eisschicht, die lange hielt und sehr tragfähig war. Man konnte dann darauf Eishockey spielen.Wir schnitten uns mit unseren Taschenmessern, welches fast jeder Junge hatte, krumm gewachsene Weidenstöcke, schälten diese und legten sie in der Nähe des Küchenherdes zum Trocknen. War das Wetter gut, ging es, wenn wir nicht zu Hause helfen mussten, nachmittags an den Badeweiher. Dort fanden sich oftmals so viele Buben ein, dass man zwei Mannschaften bilden konnte. Die meisten Familien hatten keine finanzielle Mittel um Schlittschuhe zu kaufen und so spielten wir in unseren Schuhen, die wir jeden Tag an hatten .Als Puck diente eine kleine Holzscheibe, die man aus einem Stamm oder Ast herausschnitt.Oftmals fand das Spiel erst dann ein Ende, wenn die Scheibe auf Nimmerwiedersehen im eisfreien Abfluß des Weihers verschwand.
Nach einem Fliegerangriff auf Erfenbach und als dann die Franzonen da waren, war der Badeweiher für längere Zeit gesperrt, denn man vermutete, dass Munition oder Bomben auf dem Grund des Weiher liegen könnte. Zudem waren die Gebäude stark beschädigt. Schade für die Erfenbacher, denn es waren verlorene Jahre, die man nicht zum Schwimmen nutzen konnte. Es bleiben aber viele Erinnerungen an meine Jugendzeit.
De Badeweiher“ ...eine Hommage
von Helge Ebling
Es war im Sommer 1966, ich war fünf Jahre alt und mein Vater fand, dass es an der Zeit wäre, dass ich schwimmen lernen sollte. Durch Spaziergänge mit meinen Eltern kannte ich ihn schon... den „Badeweiher“, nun sollte ich aber persönlich Bekanntschaft mit dem „nassen Element“ machen. An einem schönen warmen Wochenende ging es also zum „Strandbad Pfaffenwoog“, wie der Badeweiher offiziell hieß. Es herrschte schon reger Betrieb in und um den Weiher und ich war aufgeregt, was da auf mich zukommen würde. Schnell waren wir umgezogen und ich stand zögernd vor den Stufen, die in den Nichtschwimmerbereich führten. Die ruhige Art meines Vaters, der schon im, für ihn bauchtiefen Wasser stand und seine aufmunternden Worte lockten mich von meinem sicheren Standort auf dem Trockenen ins Wasser. Die Wassertemperaturen waren schon angenehm warm und es fühlte sich überhaupt nicht schlimm an. Was für meinen Vater Bauchtief war, war für mich, als ich ihn erreichte, schon Halstief und mir wurde dann doch etwas mulmig. Aber den Vater an meiner Seite zu wissen, beruhigte mich sehr. Er zeigte mir die ganz einfachen Schwimmbewegungen beim Brustschwimmen, indem er vor mir ein wenig auf und ab schwamm. Dann war ich an der Reihe... anfangs hielt mich mein Vater mit der Hand unterm Bauch über Wasser, während ich meine ersten, wohl nur annähernd wie schwimmen aussehende Bewegungen machte. Als er spürte, dass ich etwas sicherer wurde, nahm er auch die Hand von meinem Bauch etwas weiter weg... im ersten Moment erschrak ich und hab vermutlich den halben Weiher verschluckt... prustend und Wasser ausspuckend suchte ich wieder die sichere Hand des Vaters. Aber nach einiger Zeit und mit immer mehr Übung wurde ich auch immer sicherer und am ersten Tag gelang es mir schon, mehr schlecht als recht, ein paar Meter schwimmend zurück zu legen. Diesem ersten Tag am „Badeweiher“ sollten dann noch unzählige folgen...
Anfangs ging es mit der Mutter unter der Woche und dem Vater am Wochenende zum Weiher, als die Schule begann, dann nachmittags und in den Ferien. Da war der „Erfebacher“, wie er in der Umgebung bezeichnet wurde, noch ein Naturbadesee mit Lehm- und Sandboden und mit einfachen Umkleidekabinen aus Holz. Bademeister war zu dieser Zeit noch der liebenswürdige Herr Jörg, der unzähligen Generationen kostenlos das Schwimmen beigebracht hatte.
Dann folgte die Zeit, in der man sich mit Freunden am Badeweiher verabredete und riesig stolz war alleine dorthin gehen zu dürfen. Da war das Schwimmbad dann schon modernisiert worden und der Weiher hatte jetzt einen Betonboden und es waren moderne Umkleidekabinen errichtet worden.
Ich hatte es nicht weit von unserem Haus aus. Es ging unseren Hausberg, den „Sauerberg“ hoch, auf durch die Hitze staubig gewordenen Feldwegen... durch sich in der Sonne und Wind wiegende Getreidefelder bis zum Waldrand. Dort wurde man von einer ganz eigenen, wundervollen Mischung aus Gerüchen empfangen... es roch nach warmen Waldboden... nach Kiefernholz... nach Heidekraut... Beim Eintreten in den schmalen, dunklen, verwunschenen Pfad, der hinab zum Weiher führte, wechselten die Gerüche erneut, um einem mit einem Duft aus schwerem, im Schatten der Bäume feucht gebliebenem Waldboden zu umgeben. Links und rechts des Pfades wuchsen wilde Brombeeren und Himbeeren, die einem unwiderstehlich anzogen und eine leckere Wegzehrung waren. Von weitem hörte man schon die unverwechselbaren Geräusche eines Schwimmbades... die vielfältigen Geräusche des Wassers... das Geräusch von unbändiger Freude, der im Wasser oder auf der Wiese tobenden Kinder und Jugendlichen... die mechanisch klingenden Lautsprecherdurchsagen des Bademeister... das Hintergrundgemurmel der übrigen Badegäste... es war eine wunderschöne Melodie, die einem da entgegen schlug... eine Melodie der Kindheit und der Unbeschwertheit...
Am Eingang des Schwimmbades wurde man über viele Jahre von der netten Frau Neurohr in Empfang genommen. Ausschau haltend, wo die Freunde sich nieder gelassen hatten, sog man diese einmalige Atmosphäre in sich auf. Meist traf man auf dem Weg dorthin schon die ersten Bekannten und der freundliche Bademeister Herr Frühauf, der auf Herrn Jörg folgte, kam einem entgegen oder saß auf seinem Bademeisterstuhl. Nun war man selbst eingetaucht, selbst Teil dieses Ganzen. Nachdem man seine Decke ausgebreitet hatte, stürzte man sich zur Abkühlung ins Wasser, um dort mit seinen Freunden um die Wette zu schwimmen, vom Sprungbrett zu springen oder Reiterkämpfchen im Wasser zu machen, halt Dinge die Jungs in diesem Alter brauchen um ihren ungebändigtem Übermut.. ihrer überschüssige Energie freien Lauf zu lassen. Danach lag man erschöpft, aber glücklich auf seiner Decke, unter einem Dach aus schattenspendenden Trauerweiden, durch die gedämpftes Sonnenlicht zu einem durchdrang.
Nach und nach wurde aus der Kindheit die Jugendzeit und aus den Kinderfreunden wurde eine Jugendclique, aber man war im Sommer immer noch jeden Tag am Badeweiher. Jetzt, Mitte der Siebziger mit Kassettenrekordern und den neusten Hits, lag man weit ab von den „störenden“ Erwachsenen. Ab und an wurde man von Herrn Frühauf ermahnt die Musik etwas leiser zu stellen, was er aber mit einem Augenzwinkern tat, vermutlich seine eigene Jugend und diese aufregende Zeit im Gedächtnis. Heimlich wurden jetzt die ersten Zigaretten geraucht.. die über sechzehnjährigen schmuggelten für die Jüngeren heimlich ihr erstes Bier an den Platz... man hatte das erste Mal auch Augen für das andere Geschlecht... die ersten harmlosen Liebeleien begannen... eine Zeit des Erforschens und Ausprobierens... eine Zeit zwischen Jugend und Erwachsenwerden... eine wunderschöne Zeit...
Aber auch diese Zeit konnte man leider nicht auf Ewig konservieren und so kam der nächste Übergang... der vom Jugendlichen zum jungen Erwachsenen. Jetzt war die Zeit der Lehre oder des Studiums angebrochen und die Stunden am Pfaffenwoog wurden dadurch bedingt weniger, aber man blieb ihm immer noch treu, sei es auch mal nachts, nach einem Kneipenbesuch, um heimlich im dunklen Schein des Mondlichts die Freuden des Bades zu genießen.
Die Zeit schritt weiter voran und die Kinder von einst hatten inzwischen geheiratet und eigene Kinder, denen sie nun, wie damals ihr Vater ihnen, das schwimmen beibringen wollten. Aber da tauchten die ersten Gerüchte auf, dass die benachbarte Deponie das Bad verunreinigt haben sollte. Aus den Gerüchten wurde leider bittere Wahrheit, auf der Deponie wurden über zig Jahre aller erdenklicher Müll, von Arzneimitteln bis Chemikalien abgekippt, die das Grund- und Oberflächenwasser des Tales verunreinigten. Das Bad wurde trotz massiver Proteste der Bevölkerung geschlossen, da der Stadt und dem Land, so hieß es zumindest offiziell, die finanziellen Mittel fehlten. Nach jahrelanger Sanierung und Sicherung der Deponie, wurde das Schwimmbad zurückgebaut und das Gelände renaturiert, was zwar jetzt idyllisch aussieht, aber für all jene die den „Badeweiher“, der weit über die Ortsgrenzen bekannt und beliebt war, noch kannten, kein Ersatz darstellt.
So wurden die folgenden Generationen um etwas beraubt, dass wir noch erleben durften und was ich im Rückblick niemals vermissen möchte...
Der Dorfbrunnen „ Am Berg“
von Otto Ebling
In den alten Ortsplänen vor Neunzehnhundert ist der Brunnen „Am Berg“ bereits eingezeichnet. Nicht erkennbar ist jedoch ob es damals eine frei sprudelte Quelle aus noch früheren Zeiten war, oder ob in dieser Zeit schon ein Sandsteinbrunnentrog stand.
Im Jahre 1938 kauften wir das Haus „ Am Berg“ Nr. 5. Die Zuwegung von der Ludwigstraße aus war sehr beschwerlich, denn der steile Weg war durch tiefe Wasserrinnen ausgespült und steinig. Die Straßenrinne vor dem Dorfbrunnen war mit Sand und Küchenabfällen bis zum überlaufen voll. Die Straße war gepflastert und hatte eine Breite von ca. 4 Meter. Der Dorfbrunnen bestand in dieser Zeit aus einem Sandsteinblock mit Gussrohr, einem langen Sandsteintrog und zwei Sandsteinbänke an den Seiten. Gearbeitet aus dem Buntsandstein aus dem Steinbruch von Erfenbach. Das Wasser aus dem Trog lief in die Straßenrinne und entlang der Ludwigstraße in den Hirschbach in der Dammstraße. Vor der Dammstraße gab es eine Querrinne, wo sich öfters viel Sand staute und von den Anliegern gereinigt wurde. Es lief nicht immer gleich viel Wasser aus dem Brunnen, es schwankte je nach Jahreszeit auch versiegte es manchmal ganz. Der Belag um den Brunnen bestand aus Kopfsteinpflaster, das schon sehr ausgespült war. Einige der Nachbarn holten ihr Trinkwasser aus dem Brunnen, aber die meisten nützten es um die Gärten zu wässern. Hinter und neben dem Brunnen lagen Sandsteine die sich aus der Felswand gelöst hatten, denn im Winter sprengte das Eis im Fels große Stücke ab und durch den fast horizontalen Schichtenverlauf rutschte der Boden mit Bewuchs Richtung Brunnen. Die Brunneneinfassung war an vielen Stellen beschädigt und nicht mehr standfest. Gemeindearbeiter arbeiteten immer mal wieder an der Brunnenanlage um sie vor dem Zerfall zu retten.Im Jahre 1940 es war im März, löste sich ein ca. einen Kubikmeter großes Felsstück hinter dem Brunnen aus der Felswand und durchschlug die obere Sandsteinabdeckung. Der herabgestürzte Felsblock wurde zertrümmert und in den Weg eingebaut. Im Winter 1941/42 waren die Sitzbänke durch den Frost stark beschädigt, sodass man diese entfernen musste.
Da auch das Wasser aus der Wilhelmstraße in die Ludwigstraße lief kam es im Winter in den Wasserrinnen zu einer größeren Eisfläche, die von den Kindern zum Schlittschuhlaufen genutzt wurde. In den letzten Kriegsjahren verfiel der Brunnenplatz immer mehr und nur durch die Hilfe der Nachbarn konnte er erhalten werden.Peter Müller vom Haus „Am Berg“ Nr. 3 sorgte immer für frische Blumen und hielt Ordnung am Brunnen. Seit dieser Zeit hat der Brunnen im Volksmund den Namen "Petersbrünnche". Wenn ich aus der Schule kam war mein erster Gang zum Brunnen um den Durst zu löschen oder um meine Schuhe zu reinigen wenn wir mal wieder im Matsch gespielt hatten.
Leider wurde der Brunnenplatz später umgestaltet und lädt heute nicht mehr zum verweilen ein.